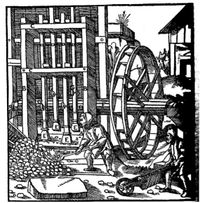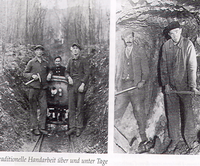Der Bergbau um Obermoschel
Die Stadt Obermoschel war im 15. und 16. Jahrhundert Zentrum des größten Quecksilber – Montanreviers Mitteleuropas. Unweit dieses Platzes stand um 1560 das Pochwerk, eine wichtige Einrichtung des frühindustriellen Bergbaus. Es wurde angetrieben durch ein Wasserrad mit dem Wasser des nahen, eigens in einem Kanal gefassten Unkenbachs. Der Maschine zum Zerkleinern des erzhalgen Gesteins war eine Schmelzhülle angeschlossen. Urkundliche Nachrichten setzen 1429 ein, als dem „meister Salman dem Juden Bergmeister“ – vermutlich aus Straßburg – im benachbarten Selberg bei Niedermoschel das Schürfrecht verliehen wurde. Die Bergwerke bestanden schon länger: „Wann diese Bergwerke zum ersten ahngegangen worden, kann man auß Mangel der acten nicht wohl ersehen.“ Vereinzelte Zeugnisse verweisen auf römischen, Indizien auf slawischen und keltischen Bergbau. Im 16. Jahrhundert entwickelten die Landesherren, die Grafen von Veldenz und späteren Herzöge von Pfalz – Zweibrücken einen frühindustriellen Bergbau. Vergünstigungen wie Freizügigkeit, Steuerbefreiung, Sondergerichtsbarkeit und Fundprämien zogen Fremde aus dem Elsass, Tirol, dem Erzgebirge oder dem ehemaligen Böhmen (heute ein Landesteil Tschechiens) in die Region. Sie wurden angeworben mit „modernen“ Arbeitsbedingungen von 3 Schichten zu je 8 Stunden. Doch die dürftigen Gewinne erzwangen Arbeitszeiten von 12 Stunden und 2 Schichten. Die Bergwerke waren als „Aktiengesellschaft“ organisiert, Investoren zeichneten Kuxe, und schlossen sich zu Gewerkschaften zusammen. Sie hatten soziale Einrichtungen erreicht, eine „Bruderbüchse“ half kranken und invaliden Bergleuten oder zahlte eine Pension aus dem Kapital des 1339 von Gräfin Agnes von Veldenz im „flecken ze moshel“ gestifteten Hospitals. Einiges spricht dafür, dass häufige Unglücksfälle auf den Bergwerken die Gründung eines Hospitals - Altenheim, Armenhaus, Herberge und Krankenhaus in einem – angeregt hatten. Die Hospitalstiftung besteht bis heute. Das große „Berggeschrey“ über enorme Gewinne lockte auch die großen Handelshäuser der Zeit, Höchstetter und Craffter aus Augsburg und Paumgartner aus Nürnberg. Vergeblich warnte der kompetente Berghauptmann Johannes Thein aus Nürnberg davor, ihnen die Gruben zu überlassen, denn „solche Monopolierer fressen die Schafe und lassen andern den Pferch.“ Der ersten Blüte des Bergbaues setzte der Tod Herzog Wolfgangs von Zweibrücken (geb. 1526) 1559 ein jähes Ende. Er hae sich durch die Bergwerke Reichtum und polisches Ansehen erhofft. Verwendet wurde Quecksilber in kleinen, teuren Dosen zu medizinischen Zwecken. Die Alchemie bevorzugte Quecksilber, weil das „quick-lebendige“ Mineral leicht auf andere Mineralien reagierte. Bedeutender wurde im 15. Jahrhundert das „Saigerverfahren“, bei dem durch Quecksilber ein höherer Ertrag bei der Verhüung silberhalgen Gesteins erzielt werden konnte. Bergbau setzte im 18. Jahrhundert erneut unter Herzog Chrisan IV. von Pfalz-Zweibrücken (1722 -1775) ein. Wie beinahe jede Herrschaft dieser Zeit war er dringend auf Erlöse aus den Bergwerken angewiesen. Er suchte die zerrütteten Staatsfinanzen durch die Verheißung des Jahrhunderts, durch Alchemie zu steigern und aus den Verbindungen mit Quecksilber Gold zu machen - erfolglos. Nach seinem Tod wurden die ohnehin ertragsschwachen Bergwerke wieder eingestellt. Den höchsten Ertrag hatten die Bergwerke im Stahlberg, Landsberg und Baumholder im Jahre 1461 erbracht, als auf der Frankfurter Messe 411 Gulden erzielt werden konnten. In diesem Jahr konnte Herzog Ludwig der Schwarze (1424 – 1489) die große Summe von 14.000 Gulden an die Stadt Frankfurt als Darlehen geben. 1509 gewann man den höchsten Ertrag von 3146 Pfund Quecksilber. Man ging von einem Ertrag von 0,1 Prozent Quecksilber – Gehalt aus. 1938 förderte man 5174 Tonnen erzhaltigen Gesteins aus den Bergen Landsberg, Stahlberg und Lemberg. Aus einer Tonne Gestein gewann man mit Hilfe moderner Drehrohr - Öfen 872,4 Gramm Quecksilber. Als der Quecksilber – Anteil auf 0,06% sank und auch während des II. Weltkrieges Quecksilber aus dem spanischen Almadén zur Verfügung stand, wurden die Bergwerke 1943 endgültig aufgelassen. Das tote Gestein – in der Fachsprache „caput mortuum“, im Volksmund „Capremotsche“ genannt – wurde als Baumaterial verwendet, in den 1960er für amerikanische Raketenbasen in der Region. Geblieben sind heute zahlreiche Stollen, auf halber Höhe des Landsberges das Bet- und Zechenhaus. Das sehenswerte Schuck`sche Haus in der Innenstadt könnte das Haus eines reichen Berghauptmannes gewesen sein. Dieser Platz ist dem Firmengründer Fritz Keiper (1881 - 1961) gewidmet. Sein Elternhaus links vom Platz wurde 1869 von seinem Vater Peter Keiper erbaut. Im Jahre 2005 konnte das Haus von Urenkel Martin Putsch erworben werden, am 19.August 2007 wurde das Keiper – Museum eröffnet. Die hochinformativen Exponate erläutern Firmen- und Automobilgeschichte und stellen die Entwicklung von der kleinen Hufschmiede zum angesehenen Weltkonzern dar. Am 15. Juli 1965 war der Grundstein gelegt worden für ein neues Werk in Rockenhausen, ein Segen für die Nordpfalz. Das Museum ist nach Vereinbarung mit dem Stadtbürgermeister zu besichtigen.
Abb. 1: Pochwerk/ Unterschrift: Aus Georgius Agricola: Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen, Basel 1556 | Abb. 2: Unterschrift: Statue des römischen Gottes Vulcanus, gefunden auf dem Lemberg | Abb. 3: Karte, Legende: „Plan über die Quecksilber Bergwercken am Landsberg, copirt von Carl Jacobin 1795“ | Abb.4: Traditionelle Handarbeit über und unter Tage | Abb. 5: Montage der modernen Drehrohröfen 1935 oder 36, mit denen der letzte Rest Quecksilber aus dem Gestein gewonnen wurde. | Diese Tafel wurde gespendet von Martin Putsch, Shareholder & Chairman of the Advisory Board der RECARO Holding GmbH. |
Haben Sie Bilder oder Dokumente über die Geschichte des Bergbaus in und um Obermoschel? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir wollen alles sammeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, bevor es verloren geht. Vielen Dank